Lalitha Chamakalayil, Dipl.-Psychologin und Wissenschaftlerin an der Hochschule für Soziale Arbeit der FHNW, spricht über zwei schwierige Themen und trifft genau den richtigen Ton, um die Schüler:innen in ihren Bann zu ziehen.
(Text und Bilder: Alexander Bieger)
Diagnosen sind keine Charakterbeschreibungen
Das Leben ist eine Achterbahn der Emotionen: Es besteht aus Höhen und Tiefen. Aber wo liegt die Grenze zwischen normalen Stimmungsschwankungen und psychischen Problemen? Nach der Definition der WHO ist psychische Gesundheit «ein Zustand des Wohlbefindens, in dem eine Person ihre eigenen Fähigkeiten ausschöpfen, die normalen Lebensbelastungen bewältigen und produktiv arbeiten kann, sowie in der Lage ist, einen Beitrag zur Gemeinschaft zu leisten». Psychische Erkrankungen sind somit «von der Norm abweichende Veränderungen, die den normalen Alltag beeinträchtigen», die uns hindern, unseren Beitrag zur Gemeinschaft, sei es im Berufsleben, in unserem Freundeskreis oder in unserer Familie zu leisten.
Aber gibt es eigentlich immer mehr psychische Erkrankungen?
Diese Frage beschäftigt viele im Publikum und sie ist tatsächlich nicht leicht zu beantworten. Lalitha Chamakalayil erklärt: «Wir profitieren von einer besseren Versorgung und mehr Aufklärung. Psychische Erkrankungen wirken weniger stigmatisierend. Paradoxerweise führt das aber auch zu höheren Zahlen, da sich mehr Menschen getrauen zur Ärztin oder zum Arzt zu gehen.»
Die nackten Zahlen sind erschreckend. Laut dem Nationalen Gesundheitsbericht der Schweiz 2025 leide jede vierte Person irgendwann in ihrem Leben an einer Angststörung. Zwischen zwanzig und vierzig Prozent der Bevölkerung würden während ihres Lebens an einer Depression erkranken. Die gute Nachricht: In den meisten Fällen gehe diese aber auch wieder weg. Psychische Erkrankungen werden heute öfter diagnostiziert als früher und das hat viele Vorteile. Diagnosen verschaffen also Sicherheit durch Erklärung. Gleichzeitig verunsichern sie aber:
«Ein Fehler ist, dass viele Leute Diagnosen als Charakterbeschreibungen oder Ursachenerklärungen verstehen», erklärt Lalitha Chamakalayil, das seien sie aber nicht.
Der Schmerz sucht sich seinen Weg
Das Thema bewegt die Schüler:innen merklich und es werden eine Menge Fragen gestellt. « Gibt es eine Erklärung dafür, warum psychische Erkrankungen bei verschiedenen Personen ganz unterschiedliche Verhaltensweisen auslösen können? », will eine Schülerin wissen.
« Warum wird jemand drogensüchtig, jemand anderes alkoholabhängig, wieso entwickelt jemand Bulimie oder verletzt sich selbst?», fragt eine andere.
«Der Schmerz sucht sich seinen Weg», erklärt Lalitha Chamakalayil. Das daraus resultierende Verhalten sei ein Symptom und oft eine Folge dessen, was zur Verfügung stehe: Alkohol sei gesellschaftlich anerkannt, normal und verfügbar. Eine Substanz wie Heroin deutlich weniger. Selbstverletzung könne mit Haushaltsgegenständen verursacht werden und Bulimie entstehe oft ohne, dass es das Umfeld merkt.
Eine andere Frage, die viele im Raum beschäftigt, ist die Frage nach der Verfügbarkeit von Therapien. Oft warten Leute Wochen oder Monate auf einen Therapieplatz. Viele versuchen es daher mit einer Art Selbsttherapie. Was sie davon halte, wird
Lalitha Chamakalayil gefragt. Die Antwort hat wohl einige überrascht. Wichtig sei es, dass man den Schmerz nicht ignoriere, sei es aus Angst, aus Scham oder auch, weil man den anderen nicht zur Last fallen wolle. Der Schmerz sei auch immer eine Form von Kommunikation. «Der Körper spricht mit uns und es hat Konsequenzen, wenn wir sehr lange nicht auf ihn hören. Bevor es Psychotherapeut:innen gab, gab es eine Community, die vieles aufgefangen hat», erklärt sie. Sich mit den Problemen auseinanderzusetzen, diese zu teilen und zu thematisieren sei sicher sinnvoller, als tatenlos auf einen Therapieplatz zu warten.
«Es gibt ein gesellschaftliches Interesse daran, dass es euch gut geht», ermutigt Lalitha Chamakalayil die Schüler:innen.. «Menschen frühzeitig zu unterstützen ist viel weniger teuer, als Sie später zu heilen.»
Rassismus – ein gesellschaftliches Strukturprinzip
Im zweiten Teil der Veranstaltung wird der Fokus auf das Thema Rassismus gelenkt.
Rassismus ist die offene Ablehnung oder auch physische Gewalt, bewusst und intentional gegen Menschen aufgrund ihrer Rassifizierbarkeit verübt. Aber es ist mehr als das. Rassismus ist ein gesellschaftliches Strukturprinzip – und nicht notwendigerweise mit Intention oder physischer Gewalt verbunden. Rassismus ist immer mit Machtverhältnissen, Zugang zu Ressourcen und anderen Möglichkeitsräumen verbunden. Lalitha Chamakalayil zeigt dies eindrücklich auf:
«Wenn ich tagsüber bei uns an der Hochschule für Soziale Arbeit an der FHNW sitze, sind ich und noch ein, zwei Personen die einzigen rassifizierten Mitarbeitenden (zum Glück ist die Studierendenschaft viel diverser)», erklärt sie. «Wenn ich am Abend lange arbeite, werden es auf einmal mehr, die aussehen wie ich.». Das Gebäude wird gereinigt, der Müll weggebracht, Sicherheitsleute beginnen ihre Schicht. «Diese Menschen sind, wie ich rassifizierbar. Und das hat etwas mit unseren gesellschaftlichen Strukturen zu tun, den Chancen und Platzanweisungen, der Art, wie Abschlüsse und Qualifikationen anerkannt oder aberkannt werden und wer wieviel Bildungschancen bekommt.».
Aber was hat das mit dem Thema psychische Gesundheit zu tun?
Lalitha Chamakalayil zeigt dies Anhand des Vulnerabilitäts-Stress-Modells. Dieses erklärt die Entstehung psychischer Erkrankungen als ein Zusammenspiel von individueller Anfälligkeit und belastenden Lebensereignissen. Das können Stressoren wie belastende Alltagssituationen, Probleme mit den Eltern oder in der Beziehung, Mobbing, Kritik, Sorgen, aber auch Perfektionismus, Krankheit oder Schmerzen etc. sein.

Die individuelle Belastungsgrenze ist von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich. Der bereits vorhandene Wasserstand im Fass symbolisiert die angeborene oder erworbene Vulnerabilität, während das einfliessende Wasser die Stressoren sind.
Wenn die Kombination aus dem schon vorhandenen Wasserstand und den hinzukommenden Belastungen die Kapazität des Fasses überschreitet und es zum Überlaufen bringt, kann eine psychische Erkrankung entstehen. Eine höhere Vulnerabilität führt also dazu, dass weniger Stress ausreicht, um eine Erkrankung auszulösen und umgekehrt. «Dieses Bild ist genial, es erklärt alles», flüstert eine Schülerin zu ihrer Kollegin. Die verschiedenen Wasserhähne wie Traumata, Genetik, Familiengeschichte haben wir alle. Racial Stress ist somit nichts anderes als ein zusätzlicher Wasserhahn, der das Fass zum Überlaufen bringen kann.
Es wird heute offensichtlich: Psychische Erkrankungen können durch zahlreiche Einflüsse ausgelöst werden. Die Veranstaltung mit Lalitha Chamakalayil zeigt, wie wichtig es ist, das Bewusstsein zu schärfen und die Augen sich selbst und seinem Umfeld gegenüber offen zu halten.
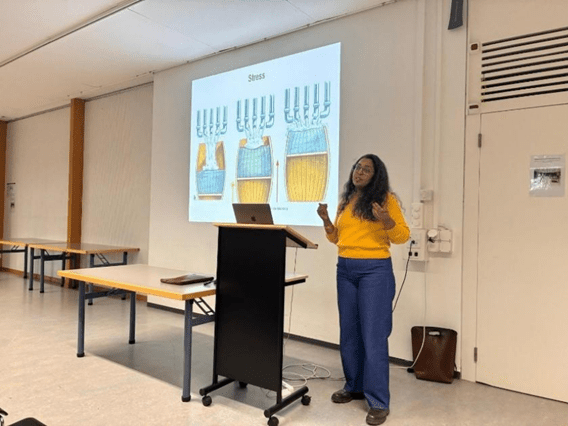
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.